Obtain your билета now. This ISE 76th Annual Meeting offers accessible demonstrations that translate electrochemistry advances into practical practice. Expect concise data, sound judgments, and a straightforward performance narrative you can apply in your lab or team.
The program foregrounds advances in anode technologies and stacks optimization, with cross-border teams from Germanys and Israelis sharing methods. april sessions spotlight new materials, scalable electrolytes, and the interplay between traditional Teutonic approaches and modern, collaborative research–all with a practical focus for real-world deployment.
Sessions map the land und citys where electrochemistry informs manufacturing and energy storage. Among the speakers, abraham leads a panel on standardization, while prayers punctuate the opening with a note of unity. The lines between academia and industry blur as teams align on shared metrics and transparent data.
Competition drives faster translation from bench to pilot lines, while technologies for safe, scalable practice help teams implement results. The conference emphasizes доступ to modular test-beds, coherent documentation, and reproducible results across sites, ensuring researchers can validate findings across multiple citys and institutions.
Prepare a collaboration plan: identify partners, set milestones, and align on data sharing. By the end of the meeting, attendees will have concrete steps to integrate new technologies into existing workflows, bridging concepts from interface to field and turning insights from ISE into measurable impact.
Catalyst and electrode material selection for PEM and alkaline electrolyzers under dynamic load
Recommendation for dynamic load operation: For PEM electrolyzers, select IrO2-based anodes on carbon-supported films with Pt-based cathodes, optimized for transient currents. For alkaline systems, deploy Ni-Fe catalysts on corrosion-resistant films attached to Ni foam, with PTFE binder to maintain durability. Establish contact with institutions in spain and other countries to compare data and verify under real-field loads, and pursue direct collaboration with researchers from pylypenko groups to validate performance across multiple setups.
Design principles密 focus on interface stability and rapid current response. Use a gradient catalyst loading to preserve contact between the catalyst layer and the diffusion layer, and apply a thin, robust film to suppress delamination during fast transients. Employ tip-enhanced characterization to map active sites at the catalyst–film interface during step changes in current and to guide iterative improvements.
In PEM stacks, prioritize anode materials that resist dissolution under oxidizing conditions while delivering acceptable OER activity. Anode options include IrO2 on Ti with a protective oxide film, paired with a high-surface-area Pt/C cathode. Keep the ionomer distribution uniform to maintain proton transport and minimize contact resistance. For dynamic events, tune the membrane-electrode assembly (MEA) architecture to reduce local overpotentials at the start of each ramp, and calibrate gas-management channels to avoid local flooding that can mask true activity.
In alkaline stacks, favor Ni-Fe oxide/hydroxide catalysts anchored on Ni substrates with a carbon-free film to minimize carbon-related corrosion. Use a PTFE-containing binder to sustain mechanical integrity under cycling. Fe doping and minor Co additions can raise OER kinetics while preserving stability under fluctuating currents. For such configurations, verify catalyst–support cohesion with photography-grade surface imaging and in-situ spectroscopy to track dissolution and phase changes during dynamic tests. Data from universitatät Pylypenko collaborators show repeatable improvements when the film is tuned for strong electrical contact and low interfacial resistance, and when starting from a clean, well-defined interface rather than a mixed, aged surface.
Testing protocol should include dynamic load steps that mimic events reported by researchers in dklb and bünting teams. Run current ramps from 0.1 to 2 A/cm2 with controlled dwell times, and monitor ECSA loss, HER/OER overpotentials, and film integrity. Use a controlled atmosphere to keep the anode and cathode films clean, and record surface changes with photography–grade imaging to document failure modes. Collect data directly from cells and store it with a consistent картой-based labeling scheme so researchers can trace measurements back to starting conditions and electrode histories.
Operational guidance for researchers and engineers includes: (1) verify contact quality between catalyst, film, and diffusion layer before each run; (2) implement a modular electrode design that allows rapid swap of catalysts in response to requested test matrices; (3) plan collaboration events that connect laboratories across countries. The approach yields more robust electrode materials for dynamic loads and accelerates translation to pilot facilities and commercial units. In Spain, ongoing demonstrations at museums and museums-like venues (музея) offer hands-on evaluations of electrode modules under real-world cycling and help align design decisions with field requirements.
Developing high-activity, low-loading catalysts to cut electrolyzer costs
Target Ir loading ≤0.2 mg Ir cm^-2 in PEM electrolyzers and push NiFe-based catalysts to sub-mg per cm^2 in alkaline cells, while delivering ≥1 A cm^-2 at 1.8 V using ultrathin film shells on conductive cores. This combination reduces catalyst expenses without sacrificing performance.
- Strategy: use ultrathin active-film catalysts on highly porous, conductive supports. Aim for film thickness in the 2–5 nm range to maximize active surface area per unit mass while ensuring robust adhesion and minimal resistance losses.
- Strategy: adopt core–shell or single-atom catalyst concepts to maximize atoms per mass and boost mass activity. Pair a highly active shell with a durable core (for example, IrO2-on-FeNi or CoP on conductive carbon) to preserve intrinsic activity at reduced loading.
- Strategy: engineer the metal–support interface to boost utilization. Doping the carbon support (N, S, or P) and tuning interfacial strength improves charge transfer and mitigates catalyst dissolution, helping achieve equal or better stability at lower metal content.
- Strategy: accelerate characterization and feedback. Implement in-situ/operando characterization (XAS, Raman, FTIR) to monitor oxidation states, surface species, and degradation pathways; use those insights to guide iterative optimization across film thickness, particle size, and support texture. Include a focused set of metrics: mass activity, specific activity, and degradation rate per 1000 hours of operation.
To translate lab success into stacks, align experiment plans with a clear cost model. For example, track catalyst cost per kW, capitalized by installation time and replacement cycles, and quantify hidden costs such as support corrosion and transport losses. The dklb framework can guide regression analyses that link loading, activity, and stability under realistic operating spectra.
The approach benefits from collaboration across topics and forums. In workshops hosted in hok kaido, researchers discuss film deposition routes, whether to deploy spin coating, sputtering, or vapor deposition, and how to scale the installation from coin cells to pilot stacks. Members share experiment results and discuss best practices (лучшие) and lessons learned, including how to maintain performance with early-stage loading reductions.
Practitioner notes:
- Experiment design: compare two catalyst families on identical supports, including film-based deposition, to isolate effects of loading and shell architecture.
- Characterization cadence: run rapid, repeated tests (TOF, mass activity, and electrochemical surface area) with operando checks every 50–100 hours to catch early degradation signals.
- Installation plan: pilot the most promising catalysts in a small alkaline module first, then migrate to a full stack, tracking cost per kW and energy efficiency at target current densities.
- Community engagement: include forums and topics that discuss equipment access (доступ) and equal opportunity for early-career researchers, with regular talks led by a founder and several longtime members.
In the field, teams located in diverse settings use early experiments to refine the film architecture. A project in a land with multiple research sites, including a lab in hokkaido, reports that ultrathin films delivering high surface density maintain stability under load swings and corrosive environments. The installation workflow benefits from a clear protocol and hidden optimization opportunities revealed by Wenzel-roughness assessments and surface-area mapping, helping teams extract more activity from each gram of metal. When discussions turn to cost, the community emphasizes not only lowered loading but also smarter integration of catalysts into installations, including standardized interfaces and modular assembly that reduce times between testing and deployment. In this collaborative spirit, talk and outreach extend to diverse audiences, including church and Christian networks, who participate in ethics-focused forums to strengthen responsible innovation and supply-chain transparency.
Durability testing protocols for electrolyzer stacks during renewable intermittency
Recommendation: adopt a harmonized, 2,000-hour intermittent-duty protocol that mirrors renewable variability and enables cross-lab comparison. Run a repeating cycle with 12 h at high-load (70–90% of rated current) and 12 h at low-load (10–20%), plus 5–10 minute ramp transitions between states every 2–3 cycles. Keep the MEA stack temperature around 60°C and stabilize inlet conditions to isolate aging effects. Record cell-level voltage, current, temperature, flow rates, and gas purity every 5–10 minutes, and perform electrochemical impedance spectroscopy at 1, 10, and 100 hours. Store results into a centralized database with dates and traceable identifiers. Target degradation: <3 mV per cell per 1,000 hours and impedance growth under 25% at 0.1 Hz over the duration. This approach reduces cross-lab variance, which supports reproducibility across teams, and provides daily insight into histories of aging, origin of failures, and the arch of advances in this field. To accelerate decision-making, teams can cook a baseline scenario and compare it with variants.
Test profile and evaluation metrics
Key metrics include voltage drift (mV per cell per 1,000 hours) and impedance growth tracked by EIS at 0.1 Hz. Maintain constant feed-water quality and inlet gas conditions to avoid confounding factors; monitor hydrogen crossover and mechanical wear indicators. Data cadence targets 5-minute intervals for core signals and scheduled EIS checks at 1, 10, and 100 hours. Apply Kalman filtering or similar smoothing to reduce sensor noise and flag outliers, with daily data validation. Document date-stamped snapshots and arch histories of failures to trace the origin of degradation. Incorporate plasmonics-informed aging indicators to broaden the insight, and provide oral updates to keep teams aligned; use welcomecard templates to onboard new participants.
Collaboration and knowledge sharing
Koordinieren Sie sich mit iaam und mehreren Foren, um Methoden und Benchmarks abzustimmen, und behandeln Sie dann Termine und Ergebnisse innerhalb von Veranstaltungen in Mainz (Mainz) und Frankfürt (Frankfürt) sowie in Teheran (Teheran) und Palästina (Palästina) und israelischen (Israelis) Labors. Teilen Sie Kochtabellen, Messmethoden und Beobachtungsgeschichten, um eine transparente Basis zu schaffen. Veröffentlichen Sie tägliche Zusammenfassungen und mündliche Kurzdarstellungen, um die Reichweite zu erhöhen, und diskutieren Sie gleichzeitig die Sillage von Unsicherheiten, um die Fehlerbalken zu verfeinern. Nutzen Sie iaam-Plattformen, um Daten und Erkenntnisse zu archivieren und so den Ursprung von Verbesserungen und den Bogen der Fortschritte in den zusammenarbeitenden Teams zu verstärken. Dieser offene Ansatz unterstützt zuverlässigere Haltbarkeitsbewertungen und beschleunigt die Umsetzung von Ergebnissen in die Praxis.
Wege zur Skalierung vom Labor zum Pilotprojekt: Tipps für Systemdesign und Integration
Beginnen Sie mit einer modularen, Plug-and-Play-Systemarchitektur, die Schnittstellen für Zellen, Elektrolyte, Sensoren und Steuerungen standardisiert. Verwenden Sie ein gemeinsames Datenmodell und ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll, um die Prozesslogik von der Hardwareauswahl zu entkoppeln. Dieser Ansatz beschleunigt den Übergang von Labordemonstrationen zu Pilotläufen und reduziert Nacharbeiten beim Skalieren von Mengen oder beim Wechseln von Anbietern.
Historien aus Laboren unter der Leitung von Wolfgang und Johannes zeigen, wie die Wahl des Elektrolyten, die Katalysatorbeladung und die Durchflusskonfiguration die Leistungssteigerung während der Skalierung beeinflussen. Die Abstimmung der Elektrolytchemie auf Katalysatoroberflächen, der Einsatz von spitzenverstärkter Diagnostik zur frühzeitigen Erkennung von Abbau und die Festlegung stabiler Betriebsfenster treiben die Transformation des Prozesses von der Konzeption zur Praxis voran. Ein Buch mit Best Practices fasst diese Erkenntnisse für die standortübergreifende Nutzung zusammen. Atanassov untersucht die Modularität; только practical note.
Implementieren Sie einen standortübergreifenden Testplan mit klaren KPIs: Energie pro Mol, Elektrodennutzung und Systemverfügbarkeit. Führen Sie für Brasilien und Norwegen parallele Skids in den Größen 5–10 l und 30–60 l mit einem gemeinsamen DC-Bus und standardisierter Elektrolythandhabung durch. Dies reduziert das Risiko und beschleunigt die Entscheidungspunkte; eine solide Datenverwaltung gewährleistet die Rückverfolgbarkeit. Dieser Ansatz bietet einen soliden Weg zu skalierbarer Leistung.
Reiselogistik ist ein Faktor im Design: Im September reisen Teams zwischen den Standorten und führen hotelbasierte Validierungssitzungen durch. Eine Museumsausstellung über elektrochemische Geschichten informiert über das Onboarding und die Praxis, und ein einziger, skalierbarer Stack untersucht die Wiederverwendung über Teams hinweg und bietet eine solide Grundlage für Kostenmodelle und Kapazitätsplanung.
Wasserstoffreinigung, -verdichtung und -speicheroptionen für Brennstoffzellensysteme
Wählen Sie einen PSA-Membran-Hybridreiniger, der 99,999 % H2 mit CO ≤ 2 ppm und einem Taupunkt unter -40 °C liefert, und kombinieren Sie ihn mit einem zweistufigen Kompressor, um 350–700 bar für die Speicherung zu erreichen. Dieses Setup minimiert die Katalysatorvergiftung und unterstützt eine stabile Brennstoffzellenleistung bei Lastwechseln. Aktuelle Daten von Teams aus Clausthal und der Schweiz zeigen einen robusten Betrieb für Zuläufe von 5 bis 50 Nm3/h, während die Vorbehandlung für Schwefelverbindungen die nachgeschalteten Einheiten sauber hält. In Deutschland ansässige Helmholtz-Forscher und Partner in der Schweiz tragen durch gemeinsame Demonstrationen bei, die auf Automobil- und stationäre Anwendungen abzielen; der Ansatz skaliert von kleinen Campus bis hin zu breiteren Campusnetzwerken in der Nähe von Flughäfen und Industriestandorten, was mit den Daten und Zeiträumen übereinstimmt, in denen Pilotläufe erforderlich sind, und der Projekterzählung eine festliche Kadenz verleiht.
Reinigungstechnologien und Leistungsziele
PSA bietet schnelles Polieren an 99.999% Reinheit, wodurch CO im niedrigen ppm-Bereich erreicht und Wasser, Schwefelverbindungen und Kohlenwasserstoffe in einem einzigen Durchgang entfernt werden. Die Vakuum-Druckwechseladsorption kann Spurenverunreinigungen weiter reduzieren, wenn die Zusammensetzung der Ausgangsstoffe schwankt, während selektive Polymer- oder anorganische Membranen eine modulare Aufbereitung ermöglichen und den Energiebedarf für den stationären Betrieb senken. Für großtechnische oder abgelegene Standorte erfüllt die kryogene Destillation hohe Reinheitsanforderungen, aber ihr Platzbedarf und ihre Investitionskosten steigen. Legen Sie die Zielgrenzwerte für Verunreinigungen fest bei CO ≤ 2 ppm, CO2 ≤ 1 ppm, H2S ≤ 0,1 ppm und ein Taupunkt unter <-40°C> um Kondensation in kühlen Klimazonen zu verhindern. Vorbehandlungsschritte sollten Schwefelverbindungen und Kohlenwasserstoffe vor der Reinigungsstrecke entfernen, um einen langfristigen Katalysatorschutz für die Brennstoffzellen zu gewährleisten. In der Praxis sollte ein kleiner, modularer Vorbehandlungsskid mit elektrotauchlackierten Komponenten bereitgestellt werden, um Korrosion bei aggressiven Einsatzstoffen zu widerstehen, insbesondere beim Betrieb in der Nähe von Clausthal oder in Schweizer Pilotanlagen.
Komprimierungs- und Speicherintegration
Wasserstoff wird in Hochdruck-Verbundstofftanks bei 350 bar (5.000 psi) oder 700 bar (10.000 psi) gespeichert, wobei 350 bar für viele stationäre und mobile Leichtanwendungen geeignet sind und 700 bar in Automobilsystemen üblich sind. Ein 70-Liter-Tank mit 700 bar speichert etwa 2,5–3,0 kg H2, während derselbe Tank mit 350 bar etwa 1,0–1,5 kg fasst, was den Dichteunterschied widerspiegelt. Für große Volumenbedarfe oder fest installierte Anlagen empfiehlt sich ein Tankverbund, um die erforderliche stündliche Liefermenge zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf schnellem Befüllen und sicherer Entlüftung liegt. Metallhydrid- und chemische Hydridoptionen bieten eine Niederdruckspeicherung mit höherer gravimetrischer Dichte, aber höherem Systemgewicht und komplexerem Wärmemanagement; diese Optionen sind attraktiv für die Langzeitspeicherung bei niedrigen Auslastungsgraden oder in netzunabhängigen Knotenpunkten, wo die Befüllzyklen selten sind. Planen Sie für integrierte Systeme den Energieverbrauch für die Kompression mit etwa 4–7 kWh/kg auf 350 bar und 8–12 kWh/kg auf 700 bar ein, wobei Wärmetausch und Standby-Verluste zu berücksichtigen sind. Von Partnern aus Michigan und der Schweiz präsentierte Projekte zeigen, dass modulare Speicherzüge, einschließlich Inline-Aufreinigung, Vorkonditionierung und intelligenter Steuerung, die Zyklenstabilität in verschiedenen Lastprofilen verbessern. Wenn Sie in der Nähe von Clausthal oder in festlichen Forschungswochen eingesetzt werden, planen Sie ein flexibles Speichermodul mit Schnellwechselanschlüssen ein, um unterschiedlichen Zufuhrzusammensetzungen Rechnung zu tragen.
Technoökonomische und ökologische Lebenszyklusanalysen für Wasserelektrolyseprojekte
Beginnen Sie mit einem modularen TEA-LCA-Framework, das parallel zu Pilotdaten und Online-Informationsfeeds läuft. Definieren Sie frühzeitig Cradle-to-Gate- und Cradle-to-Grave-Grenzen und legen Sie eine gemeinsame Datentemplate fest, damit Aktualisierungen an Aveiro-Standorten oder anderen Campussen in allen Szenarien übernommen werden. Bauen Sie das Modell, um PEM-, alkalische und Festoxid-Varianten unter regionalen Strommixen, Kohlenstoffpreisen und politischen Anreizen zu vergleichen, und legen Sie einen Ziel-LCOH unter 2,50 USD/kg H2 für kurzfristige Einsätze fest, bei denen erneuerbare Energien im Überfluss vorhanden sind.
Quantifizieren Sie in TEA die Investitionsausgaben (CAPEX) im Bereich von 900–1.600 USD pro kW für PEM und 700–1.300 USD pro kW für alkalische Systeme, wobei die Betriebs- und Wartungskosten (O&M) etwa 0,8–2,5 % der Investitionsausgaben pro Jahr betragen. Beziehen Sie Nebenanlagen (BOP), Wasseraufbereitung und Standby-Verluste ein, und modellieren Sie Lernkurven, die die Investitionsausgaben nach 2–3 Lernraten um 15–25 % reduzieren. Bewerten Sie Elektrizität als die dominierende variable Eingangsgröße, indem Sie regionale Preisprognosen und zeitabhängige Tarife verwenden, um stündliche LCOH-Profile zu erstellen. Berichten Sie über die Sensitivität gegenüber Strompreis, Diskontsatz und Stack-Effizienz, damit Investoren die Auswirkungen von politischer Unterstützung oder Corporate-Offtake-Vereinbarungen erkennen können.
Die Ökobilanzierung sollte einem Cradle-to-Grave-Ansatz folgen, der die vorgelagerte Materialgewinnung, die Herstellung, die Installation, den Betrieb, die Wartung und das Recycling am Ende der Lebensdauer erfasst. Verwenden Sie eine konsistente Funktionseinheit – 1 kg Wasserstoff, der an der Systemgrenze bereitgestellt wird – und geben Sie das Treibhauspotenzial (GWP), die Wasserintensität und die Partikelemissionen als Kernindikatoren an. Wenn der Strom aus Netzen mit hoher fossiler Kohlenstoffintensität bezogen wird, kann sich der CO2-Fußabdruck des Prozesses im Vergleich zu Ökostromszenarien verdoppeln; quantifizieren Sie diese Aufteilung unter Verwendung verschiedener regionaler Netze und saisonaler erneuerbarer Energiemixe. Verknüpfen Sie tägliche Betriebsdaten mit Umgebungsbedingungen – Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung –, um Lebenszyklusinventare mit standortspezifischen Daten zu verfeinern.
Integrierter Bewertungsrahmen und praktische Schritte
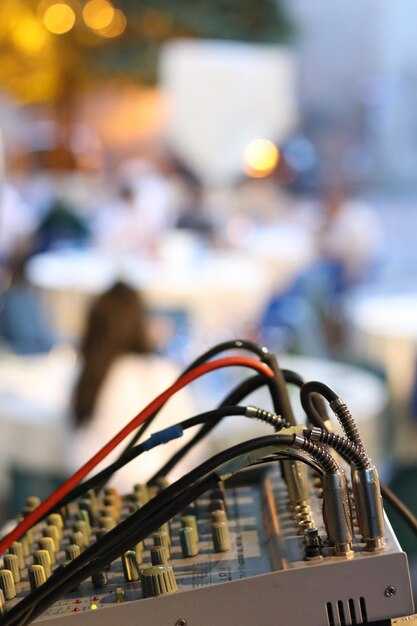
Schritt 1: Legen Sie eine "Periode-Eins"-Grundlinie fest, indem Sie die aktuelle Elektrolyse-Hardware an einem mittelgroßen Standort verwenden und sie mit Spektro-Photo-Elektrochemie-Diagnostik koppeln, um Effizienzverluste in Echtzeit zu ermitteln. Schritt 2: Führen Sie drei bis fünf Szenarien durch, darunter einen Basisnetzmix, einen 50/50-Wind-Solar-Mix und ein 100% erneuerbares-Energien-Szenario, und übersetzen Sie die Ergebnisse dann in LCOH- und GWP-Bereiche. Schritt 3: Integrieren Sie Biokatalyse- und Prozessintegrationsoptionen als ergänzende Technologien und bewerten Sie deren inkrementelle CAPEX und potenzielle Synergien für co-produzierte Chemikalien. Schritt 4: Erstellen Sie ein Online-Dashboard, das zeitaufgelöste Metriken präsentiert – CAPEX pro kW, O&M pro kg H2, LCOH und CO2-Intensität – gepaart mit Luftbild-Standortbewertungen und täglichen Produktionsprofilen.
Die Inhalte von Universitäten, wie z. B. der Universität in Europa und den Kollaborationsknoten in Aveiro, sollten das Modell mit periodenspezifischen Daten versorgen, einschließlich aktualisierter Moduleffizienzen und neuer Katalysatoren. Beziehen Sie Beiträge von Interessenvertretern an verschiedenen Standorten ein – einschließlich der Gruppen Karl und Metzger –, um Best Practices in den Bereichen gebaute Infrastruktur, Dark-Sky-Energieplanung und kreative Standortwahl zu erfassen. Nutzen Sie videobasierte Präsentationen und Online-Informationsaustausch, um Entscheidungszyklen zu beschleunigen und persönliche und betriebliche Zeitpläne einzuhalten: Weisen Sie Zeitblöcke für empfangene Daten, präsentierte Ergebnisse und Entscheidungspunkte zu.
Datenqualität ist wichtig: Dokumentieren Sie die Messunsicherheit für jeden Parameter, von der Stapelwirksamkeit bis hin zu den Katalysatorabbaugeschwindigkeiten, und übertragen Sie diese Unsicherheiten durch Monte-Carlo-Analysen, um robuste Entscheidungsgrundlagen aufzuzeigen. Betonen Sie für ökologische Vorteile die Reduzierung der Kohlenstoffintensität durch erneuerbare Energien vor Ort, Wasserkreislaufwirtschaft und Materialien mit geringem ökologischen Fußabdruck. Stellen Sie bei der Ergebnisberichterstattung sowohl Mid-Point-Indikatoren (z. B. GWP, Primärenergiebedarf) als auch Endpunktindikatoren (z. B. menschliche Gesundheit und Ökosystemqualität) dar, um sicherzustellen, dass die Interessengruppen die Ergebnisse in konkrete Maßnahmen umsetzen können.
Stellen Sie schließlich sicher, dass der Prozess partizipativ ist: Organisieren Sie regelmäßige (monatliche) Updates, kurze tägliche Stand-ups mit den Baustellenteams und vierteljährliche Überprüfungen, die Feedback von verschiedenen Gruppen – einschließlich Gemeinde- und Investorenvertretern – einbeziehen, damit die TEA-LCA auf die Marktbedürfnisse und Nachhaltigkeitszusagen abgestimmt bleibt. Das Ziel ist ein transparenter, datengestützter Weg von ersten Studien zu gebauten, betriebsbereiten Anlagen mit messbaren Kohlenstoffreduktionen und Kostenvorteilen, die ein breites Publikum verstehen und unterstützen kann.

 ISE 76. Jahrestagung – Fortschritte in der Elektrochemie und Zusammenarbeit">
ISE 76. Jahrestagung – Fortschritte in der Elektrochemie und Zusammenarbeit">

Kommentare